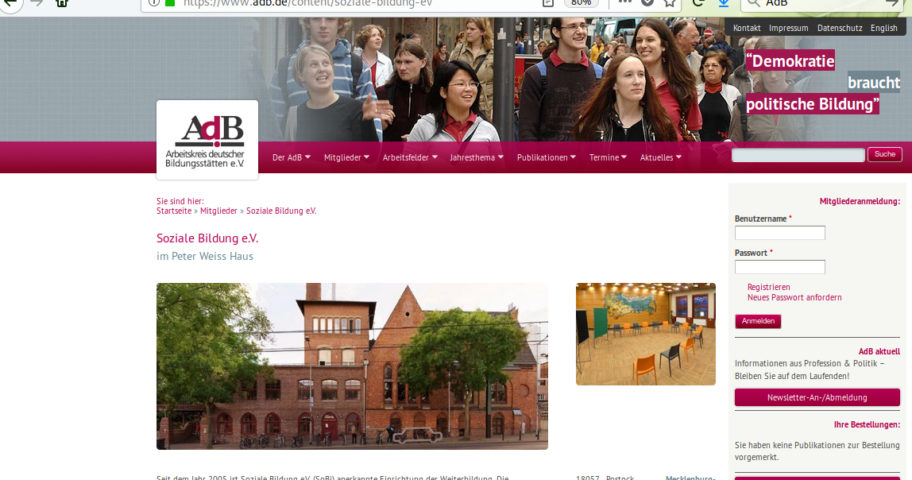Seit 2016 sind wir Mitglied im Arbeitskreis deutscher Bildungsstätten (AdB).
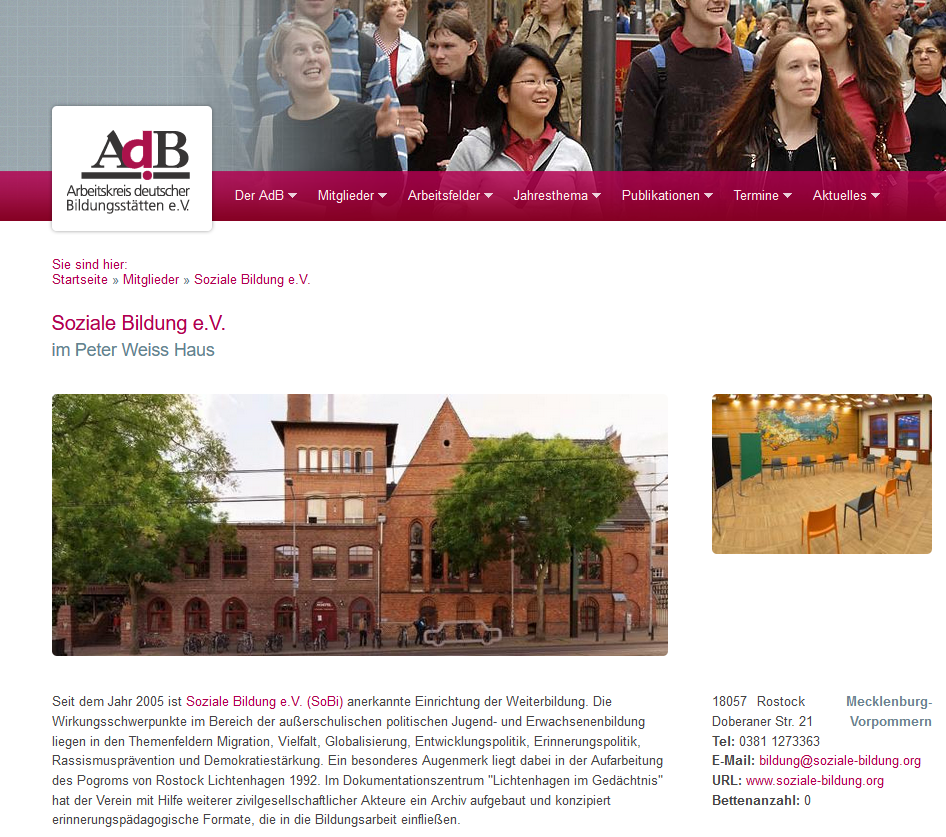
Als Verein bringen wir uns bereichsübergreifend in die Verbandsarbeit des bundesweiten Netzwerk des AdB ein und beteiligen uns im Rahmen verschiedener Kommissionen und Kooperationsprojekt an der Vereinsarbeit.
Soziale Bildung e.V. ist in dem Rahmen in drei Kommissionen aktiv:
- Verwaltung und Finanzen
- Jugendbildung
- Europäische und Internationale Bildungsarbeit
Darüber hinaus ist Soziale Bildung e.V. mit einer Jugendbildungsreferent*innenstelle in der aktuellen Programmlaufzeit (2023-2028) des Programms „Politische Jugendbildung im AdB“ in der Fachgruppe „Soziale Frage und politische Teilhabe“ aktiv.